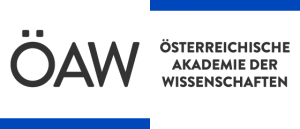SYMPOSIUM UND PODIUMSDISKUSSION
Selbstbestimmung als Utopie?
Symposium und Podiumsdiskussion
Selbstbestimmung als Utopie? Volksabstimmungen 1920 im europäischen Vergleich
Mittwoch, 7. Oktober 2020
Universität Klagenfurt | Hörsaal 1 | Universitätsstraße 65-67 | 9020 Klagenfurt
In den programmatischen „14 Punkten“, mit denen US-Präsident Woodrow Wilson Anfang 1918 seine Vorstellungen für die Neuordnung Europas und die Ausgestaltung der internationalen Gemeinschaft nach dem Ersten Weltkrieg darlegte, fand sich die Habsburgermonarchie an mehreren Stellen angesprochen: Die Grenzen Italiens sollten entlang klar erkennbarer Linien der Nationalität gezogen werden, auf den Gebieten unbezweifelbar polnischer Bevölkerung sollte ein unabhängiges polnisches Staatswesen neu entstehen, vor allem aber sollte den „Völkern“ der Doppelmonarchie die „freieste Möglichkeit zu autonomer Entwicklung“ zugestanden werden.
Wilsons Vorstellungen von einem moralisch gerechten Frieden erfuhren durch die sozialistischen Revolutionen von 1917/18, die divergierenden Interessen der europäischen Siegermächte und die komplexe multilaterale Verhandlungssituation auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 eine Reihe von Herausforderungen. Letztlich erwies sich das universalistische Versprechen von autonomer Entwicklung und Selbstbestimmung als zu breite Projektionsfläche für die unterschiedlichsten politisch-ideologischen Ziele – diese reichten von der kommunistischen Weltrevolution über demokratische Selbstregierung und nationale Unabhängigkeit bis zu dezidierten Strategien ethnischer Absonderung.
Harte Friedensbestimmungen mit explizitem Strafcharakter zeichneten zehn neue Staaten auf der Landkarte Mittel- und Osteuropas ein, die ethnisch keineswegs homogen gebildet werden konnten und selbst wieder „kleine Imperien“ darstellten (Pieter M. Judson). Um Konflikte bei der Bildung dieser neuen Vielvölkerstaaten zu minimieren, schien ein erst im Lauf der Verhandlungen eingeführtes Prinzip einen Ausweg zu bieten: die betroffene Bevölkerung über ihre staatliche Zugehörigkeit selbst entscheiden zu lassen.
Geht man der Umsetzung dieses Prinzips nach, so bietet der Blick auf Europa ein ganzes Panorama von Optionen. Häufig genug wurde dabei weiterhin militärische Gewalt eingesetzt – gerade dort, wo Gebietszuweisungen umstritten waren wie in Fiume/Rijeka, Vilnius/Wilna oder Smyrna/Izmir. Danzig wurde Freie Stadt unter dem Schutz des Völkerbundes, das Gebiet nördlich der Memel von französischen Truppen besetzt. In Eupen-Malmedy wurde ein Optionsverfahren mit öffentlicher Listeneintragung für eine allfällige Rückkehr von Belgien an Deutschland aufgesetzt, im Saargebiet eine Volksabstimmung um 15 Jahre verschoben und die Nutzung der industriellen Ressourcen für die Zwischenzeit Frankreich übertragen. Das „Anschlussverbot“ untersagte der Republik Deutsch-Österreich 1919 den angestrebten Zusammenschluss mit Deutschland, während nicht autorisierte Abstimmungen in Tirol und Salzburg noch 1921 noch deutliche Mehrheiten dafür ergaben. Die mehrheitlich deutschsprachigen Gebiete Westungarns hatte der Frieden von St. Germain Österreich zugesprochen, doch kehrte hier Ödenburg/Sopron nach einer bilateral akkordierten Abstimmung (Dezember 1921) nach Ungarn zurück. Referenden über die künftige staatliche Zugehörigkeit in genau festgelegten Abstimmungsgebieten fanden 1920 nicht nur im Süden Kärntens statt (10. Oktober, festgelegt im Art. 50 des Friedensvertrags von St. Germain), sondern auch in Schleswig (Februar/März), in West- und Ostpreußen (Juli) sowie, im März 1921, in Oberschlesien.
Mit dem Symposium in Klagenfurt, das gemeinsam von der Universität Klagenfurt, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem Land Kärnten ausgerichtet wurde, wurden diese Abstimmungen im Vergleich betrachtet und in das komplexe Panorama europäischer Staatsbildungsprozesse in der kritischen Nachkriegsphase von 1918/20 eingeordnet. Darüber hinaus wurden in Keynotes und Diskussionen weiter gespannte Problemlagen erörtert , die zur Entwicklung zu einem „Langen Ersten Weltkrieg“ beitrugen. Dazu gehört, im globalen Kontext, die Bedeutung des „Wilsonian Moment“, der als Entwurf für eine neue Weltordnung auf Basis des Selbstbestimmungsrechts der Völker verstanden werden konnte. Die Forderungen kolonialer Gebiete nach politischer Souveränität im selbstbestimmten Nationalstaat aber scheiterten nicht nur, sondern die imperialen Mächte Großbritannien und Frankreich vergrößerten ihre Einflusszonen über die sog. „Mandatsgebiete“ des Völkerbundes nochmals beträchtlich.
So blieb das Recht freier Selbstbestimmung für alle Völker letztlich eine Utopie – in Europa selbst wie auch im Machtbereich der europäischen Siegermächte. Der Friede von 1919 erwies sich binnen kurzem als „überfordert“ (Jörn Leonhard), als ein Kompromiss, mit dem bald alle haderten. Statt einer neuen, friedlichen Weltordnung entstanden Instabilität und Konflikträume, die bis heute nachwirken.
Reinhard Stauber (Universität Klagenfurt)
Symposium
Begrüßung durch Oliver Vitouch | Rektor der Universität Klagenfurt
Opening Keynote: Oliver Jens Schmitt | Präsident der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW und Universität Wien | Zwischen Selbstbestimmung und Plebiszit. Neue Grenzen und die Beteiligung der Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg.
Oliver Jens Schmitt ist Universitätsprofessor für Geschichte Südosteuropas an der Universität Wien und Präsident der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, deren Forschungsbereich „Balkanforschung“ er leitet. Er hat eine Geschichte des Kosovo und eine Geschichte der Albaner veröffentlich; zuletzt erschien „Der Balkan im 20. Jahrhundert. Eine postimperiale Geschichte“ (2019).
Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs erhoben den Anspruch, auf dem Boden der untergegangenen Imperien ein demokratischeres Europa zu schaffen. Die Ziehung der Grenzen zwischen Siegern und Verlierern, aber auch zwischen Siegerstaaten und ihren Verbündeten erwies sich als nur schwer zu überwindende Hürde. In einigen Fällen wurden Volksabstimmungen angesetzt, um die Entscheidung auf den Willen der Betroffenen zu stützen. In vielen Fällen wurde zwar über ein Plebiszit diskutiert, von einer Durchführung aber angesehen. Wie sind die Volksabstimmungen zu bewerten bei der großen territorialen Neuordnung Europas? Nach welchen Prinzipien wurden sie beschlossen und durchgeführt? Wie sind die Ergebnisse zu deuten? Und welche Folgen zeitigten Plebiszite über die Zugehörigkeit eines Gebiets? Diesen Fragen geht der einleitende Vortrag nach.
Jan Schlürmann | Schleswig-Holsteinischer Landtag, Kiel | Das Selbstbestimmungsrecht und die Volksabstimmung im Herzogtum Schleswig 1920 – Modellfall oder Sonderfall?
Jan Schlürmann ist Referent im Präsidialbüro des Schleswig-Holsteinischen Landtags und Autor eines Buchs zu den Volksabstimmungen über die deutsch-dänische Grenze („1920. Eine Grenze für den Frieden“ (2019)).
Die Volksabstimmung in Schleswig unterschied sich in vielerlei Hinsicht von den Abstimmungen im übrigen Deutschen Reich und in Deutsch-Österreich. Ihr Verlauf war weitgehend friedlich, ihr Ergebnis wurde zwar von beiden Seiten in Frage gestellt, aber zu keiner Zeit – selbst nach der Besetzung Dänemarks durch die Wehrmacht 1941 – wieder revidiert. Auch ihr Zustandekommen ist ungewöhnlich: in den 14 Punkten Wodroow Wilsons taucht die „Schleswig-Frage“ gar nicht auf und Dänemark selbst war den Krieg über neutral. So kam es bereits Anfang Oktober 1918 zu bilateralen Gesprächen zwischen der Reichsregierung und Vertretern der dänischen Minderheitenvertreter über eine Volksabstimmung – ein Verfahren der Grenzneuordnung, das im deutsch-dänischen Grenzland bereits seit 1831 diskutiert worden war. Erst der alliierte und auch der nationaldänische Druck verlagerten die Frage dann nach Versailles, wo sich in der Debatte das vorangegangene Jahrhundert mit seinen nationalistischen Maximalforderungen in Kurzform zu wiederholen schien. Dass sich die deutsch-dänische Grenze dann jedoch als stabilste deutsche Außengrenze erwies, lässt aufhorchen.
Wie ordnen sich diese Vorgänge nun in den Kontext der Nachkriegs-Abstimmungen und vor allem auch in die Entwicklung des Konzepts der „Selbstbestimmung der Völker“ ein? „Modellfall“ oder „Sonderfall“? – Im hohen Norden jedenfalls liefen die Dinge ein wenig anders.
Andreas Kossert | Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Berlin | „Weil sie aus dem Heimatgedanken eine Religion machten …“ Die Volksabstimmung am 11. Juli 1920 in Ostpreußen (Text wurde von Dieter Pohl verlesen)
Andreas Kossert ist Wiss. Mitarbeiter und Leiter des Bereichs „Dokumentation und Forschung“ bei der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Er hat über Masuren und die Geschichte der deutschen Vertriebenen („Kalte Heimat“, 2008) publiziert; gerade erscheint sein neues Buch „Flucht. Eine Menschheitsgeschichte“ (2020).
Kaum ein Ereignis hat die Gemüter in der ostpreußischen Geschichte derartig bewegt wie die Volksabstimmung am 11. Juli 1920. Der 1918 als Staat wiedererstandene Nachbar Polen fordert selbstbewusst bislang deutsche Gebiete und kann dabei auf eine ihm gewogene Stimmung auf der Pariser Friedenskonferenz zählen. Mit diesen Forderungen überspannt die polnische Delegation jedoch selbst bei ihren alliierten Bündnispartnern den Bogen. Während Posen und der Großteil Westpreußens ohne Wenn und Aber Polen zugesprochen wird und die Zweite Republik damit einen freien Zugang zur Ostsee erhält, sieht der Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919 für die umstrittenen Grenzgebiete in Ostpreußen (Masuren und das südliche Ermland) und einem Teil Westpreußens die Ansetzung einer Volksabstimmung vor. Obwohl die deutsche Seite angesichts der polnischen Forderungen sofort protestiert, bedeutet die Festsetzung der Abstimmung für die Bezirke Allenstein und Marienwerder – so die offizielle Bezeichnung im Versailler Vertrag – auf den 11. Juli 1920 bereits eine Niederlage für die polnische Delegation, deren Ziel, die Regionen ohne plebiszitäre Entscheidung mit dem polnischen Mutterland zu vereinigen, damit fehlgeschlagen war.
Spätestens seit dem überwältigenden deutschen Abstimmungssieg wird Ostpreußen zu einem Mythos; ein von feindlichen Mächten umtostes Grenzland. Überall beschwört man einen neuen Grenzlandgeist. Die im Vorfeld der Volksabstimmung entstandenen Heimatverbände agitieren weiter gegen Polen, aber vor allem gegen die deutsche Demokratie. Grenz- und Heimatwehren nutzen die Angst vor einer polnischen Invasion zu ihren Gunsten. Auch auf polnischer Seite wird die Niederlage beim Plebiszit bis in die jüngste Gegenwart nationalistisch instrumentalisiert. Der 11. Juli 1920 wird zum Schlüsselerlebnis für die weitere politische Radikalisierung und damit eine Grenzlandschaft zwischen Deutschland und Polen in einem nationalistischen Legitimationskampf aufgerieben.
Maciej Górny | Dt. Historisches Institut Warschau | Oberschlesien und die Grenzen der Selbstbestimmung
Maciej Górny ist Wiss. Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau und ao. Professor am Historischen Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Zusammen mit Włodzimierz Borodziej ist er Verfasser des zweibändigen Werks „Der vergessene Weltkrieg. Europas Osten 1912-1923“ (2018).
Die Volksabstimmung in Oberschlesien (März 1921), zusammen mit den beiden vorangegangenen polnischen Aufständen in der Provinz (1919 und 1920), dem dritten und letzten Aufstand im direkten Anschluss an die Bekanntmachung der Ergebnisse und schließlich samt der parallelen halboffiziellen Verhandlungen der Siegermächte, gehören zu den besten Illustrationen des mit dem Selbstbestimmungsgedanke verbundenen Problems der Identität. Die Frage der nationalen und staatlichen Zugehörigkeit stellte nicht nur Politiker, sondern auch Wissenschaftler vor eine Herausforderung, auf die weder die Regierungen, noch ethnische Statistik vorbereitet waren. Die Plebiszite sowie die ersten Volkszählungen nach 1918 lieferten ihnen eher Fragen als Antworten. Der Vortrag von Maciej Górny wird die Gedankengänge der wissenschaftlichen Experten und Politikmacher verfolgen, die die neue Welt erfassen und ordnen versuchten.
Gábor Egry | Institut für Politische Geschichte, Budapest | Nationale Selbstbestimmung ohne Nationen? Das Ende des Ersten Weltkrieges und die neue Grenze in Westungarn
Gábor Egry ist Director-general und Senior Research Fellow am Institut für Politische Geschichte in Budapest. Er befasst sich, u.a. in einem ERC-Grant-Projekt, mit Minoritäten und Migration in Ostmitteleuropa nach 1918. Zuletzt erschien eine Monographie in ungarischer Sprache über die Minderheitenproblematik in Rumänien und in der Tschechoslowakei 1918-1944 (2015).
Der Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie war eine Revolution, die auf Mobilisierung der Bevölkerung beruhte, und neben dem Anspruch auf nationale Selbstbestimmung oft auch soziale Forderungen formulierte. Westungarn, das spätere Burgenland, war von ethnischer, sprachlicher und sozialer Vielfalt geprägt; die Revolution und die darauffolgenden Staatsbildungsprozesse, darunter auch Österreichs Wunsch nach einem Anschluss, stellte die Bevölkerung mehrmals vor die Frage, mit welchem Staat, welcher Nation oder sozialen Kategorie sie sich identifizieren wollte. Besonders nach Proklamation des sog. „Lajtabánság (Leithabanats)“ und während der Kampagne für die Volksabstimmung war es schwer, eine solche Identifikation zu vermeiden. Obwohl die Idee der nationalen Selbstbestimmung voraus setzte, dass jeder sich zu einer Nation, und zwar nur zu einer, bekannte, und andere mögliche Formen und Quellen von Identität oder Loyalität der Nation untergeordnet wurden, zeigten die vier Jahre von 1918 bis 1922, dass Individuen von solchen Erwartungen häufig abwichen. Obwohl die Volksabstimmung zuletzt den territorialen Streit stilllegte, stand sie eher am Anfang als am Ende der Ausdifferenzierung deutscher und ungarischer Identität im neuen Grenzgebiet.
Arnold Suppan | ÖAW und Universität Klagenfurt | Kärntens Volksabstimmung 1920
Arnold Suppan ist emeritierter o. Universitätsprofessor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien und war Obmann der Historischen Kommission, Generalsekretär und Vizepräsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er zeichnet verantwortlich für die zwölf Editionsbände der Dokumente zur Außenpolitik der ersten österreichischen Republik. Zuletzt erschien von ihm in neuer Auflage „Hitler – Beneš – Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa“ (2017).
Der Beitrag erörtert einleitend die Frage, welche Gebietsansprüche die Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie stellten und welche Bedeutung militärische Aktionen für die Durchsetzung dieser Gebietsansprüche hatten. Die Besetzung von Gebieten durch italienische, serbische, rumänische, polnische und tschechische Ententetruppen schufen vollendete Tatsachen, die von der Friedenskonferenz akzeptiert wurden. Zwischen dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS) und der Republik (Deutsch-)Österreich waren 13 Kärntner und 11 steirische Gerichtsbezirke umstritten, in denen nach der Volkszählung 1910 239.000 slowenisch- und 218.000 deutschsprachige Kärntner und Steirer lebten. Da die in der Untersteiermark und in Unterkärnten operierenden südslawischen Truppen keine Ententetruppen waren, war militärischer Widerstand möglich, der von den Alliierten auch nicht verboten wurde.
Die von US-Präsident Wilson nach Wien entsandte „field mission“ unter Leitung des Harvard-Professors Coolidge sollte die nationalen Verhältnisse in der aufgelösten Habsburgermonarchie studieren. Auf Ersuchen der Kärntner Landesregierung entsandte Coolidge zwei Offiziere zu den Waffenstillstandsverhandlungen in Graz. Ohne entsprechendes Mandat machten Obstlt. Miles und Lt. King dennoch einen Vermittlungsvorschlag, der von den beiden Streitparteien angenommen wurde. So bereisten die beiden Offiziere in Begleitung des Historikers Kerner und des Geographen Martin Ende Jänner/Anfang Februar 1919 das Kärntner Unterland und erstatteten Coolidge Bericht. Während Miles, King und Martin die Karawanken als Demarkationslinie vorschlugen, empfahl Kerner die Drau ab der Einmündung der Gail; im Übrigen empfahlen beide die Belassung Marburgs bei Österreich. Coolidge und Wilson hielten beide am Miles-Bericht fest.
Die alliierten Mächte waren grundsätzlich an Volksabstimmungen desinteressiert und lehnten diese auch für die böhmischen und ungarischen Länder ab, ebenso für das Küstenland und Südtirol. Nur auf ausdrückliches Insistieren von Lloyd George wurde eine Volksabstimmung in Oberschlesien festgelegt und auf ausdrückliches Insistieren von Wilson eine solche in Unterkärnten. Weder neuerliche Kampfhandlungen in Unterkärnten noch Interventionen der höchsten slowenischen Würdenträger beim US-Präsidenten konnten die Festlegung der Volksabstimmung abwenden.
Die Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 wurde unter strenger Aufsicht einer interalliierten Plebiszitkommission durchgeführt. Von 39.000 Abstimmungsberechtigten (darunter fast 70 % Slowenischsprachige) votierten 22.025 für Österreich und 15.279 für Jugoslawien. Entscheidend waren die wirtschaftliche Verbundenheit mit dem Marktplatz Klagenfurt, die Einbindung der Industriearbeiter und Eisenbahner in die Organisationen der deutsch-österreichischen Sozialdemokratie, Zwangsmaßnahmen der slowenischen Verwaltung, Fürsorgeaktionen der Wiener Staatsregierung und der Kärntner Landesregierung, sowie die Propaganda gegen das serbisch-orthodoxe Königshaus und die allgemeine Wehrpflicht in Jugoslawien. Das Ergebnis der Plebiszits wurde von der Plebiszitkommission sofort anerkannt, von der alliierten Botschafterkonferenz in Paris am 3. November 1920.
Keynote & Podiumsdiskussion
Eröffnung durch Peter Kaiser | Landeshauptmann von Kärnten
Keynote Jörn Leonhard | Universität Freiburg im Breisgau | Der überforderte Frieden: Selbstbestimmung zwischen Erwartung und Erfahrung nach 1918
Jörn Leonhard ist Universitätsprofessor für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Universität Freiburg im Breisgau, Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und Honorary Fellow des Wadham College der Universität Oxford. In den letzten Jahren hat er zwei umfangreiche Gesamtdarstellungen zur globalen Geschichte des Ersten Weltkriegs („Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs“ (2014, übersetzt ins Englische und Chinesische und mehrfach mit Preisen ausgezeichnet)) und der Nachkriegsjahre 1918-1923 („Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt 1918-1923“ (2018)) vorgelegt.
Als im Frühjahr 1919 aus aller Welt Diplomaten und Staatsmänner nach Paris kamen, um den größten Krieg zu beenden, den die Welt bis dahin gesehen hatte, und eine neue Friedensordnung zu errichten, lag eine ungeheure Aufgabe vor ihnen. Die Friedenskonferenzen von Paris 1919/20 konfrontierten die Zeitgenossen noch einmal mit den globalen Folgen eines industrialisierten Massenkriegs, in dem mit immer längerer Dauer immer umfassendere Erwartungen an die Nachkriegsphase entstanden waren. Das zeigte sich ab 1917, als mit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, der Oktoberrevolution der Bolschewiki und den Friedensprogrammen des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilsons und W. I. Lenins eine Binnenschwelle des Krieges erreicht war. „Self determination“ als demokratische Selbstregierung und nationale Selbstbestimmung avancierte vor diesem Hintergrund zu einem Schlüsselbegriff der Nachkriegsordnung – ob in den neuen, aus den multiethnischen Imperien entstehenden Staaten oder den vielen Regionen, deren Zugehörigkeit umstritten blieb. Welche Erwartungen die Zeitgenossen mit dem neuen Konzept verknüpften, und welche Probleme und Widersprüche sich in der Praxis vor Ort entfalteten, beleuchtet der Vortrag in einem internationalen Vergleich. Hier erwies sich exemplarisch, dass der Moment von 1919/20 weit über die Friedensverträge von Versailles, St. Germain, Trianon, Sèvres und Lausanne hinaus eine Probe für das bedeutete, was man bis in die Gegenwart als Grundproblem der modernen Politik verstehen kann – die doppelte Spannung zwischen Erwartung und Erfahrung und zwischen dem Sagbaren und dem Machbaren.
Podiumsdiskussion
Es sprechen:
Jörn Leonhard ist Universitätsprofessor für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Universität Freiburg im Breisgau, Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und Honorary Fellow des Wadham College der Universität Oxford. In den letzten Jahren hat er zwei umfangreiche Gesamtdarstellungen zur globalen Geschichte des Ersten Weltkriegs („Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs“ (2014, übersetzt ins Englische und Chinesische und mehrfach mit Preisen ausgezeichnet)) und der Nachkriegsjahre 1918-1923 („Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt 1918-1923“ (2018)) vorgelegt.
Jana Osterkamp ist Privatdozentin an der Universität München, Wiss. Mitarbeiterin des Collegium Carolinum in München und Co-Leiterin eines österreichisch-deutschen Forschungsprojekts über Entscheidungsprozesse in der Kabinettskanzlei Kaiser Franz Josephs. Ihr von der DFG gefördertes Habilitationsprojekt betraf „Eine Gesellschaftsgeschichte des Föderalismus. Föderale Ordnungsvorstellungen in der Habsburgermonarchie“, in dessen Umkreis mehrere Aufsätze und ein Sammelband („Kooperatives Imperium“ (2018)) erschienen sind.
Dieter Pohl ist Universitätsprofessor für Zeitgeschichte mit besonderer Berücksichtigung Ost- und Südosteuropas an der Universität Klagenfurt und Mitglied der bilateralen Historiker-Kommissionen Österreichs mit Russland und der Ukraine. Monographisch hat er sich mit der Verfolgung der Juden in Ostgalizien 1941-1944 (1996) und der deutschen Militärbesatzung in der Sowjetunion („Die Herrschaft der Wehrmacht“ (2008)) beschäftigt; außerdem ist er Mitherausgeber der Editionsreihe „Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945“ .
Oliver Jens Schmitt ist Universitätsprofessor für Geschichte Südosteuropas an der Universität Wien und Präsident der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, deren Forschungsbereich „Balkanforschung“ er leitet. Er hat eine Geschichte des Kosovo und eine Geschichte der Albaner veröffentlich; zuletzt erschien „Der Balkan im 20. Jahrhundert. Eine postimperiale Geschichte“ (2019).
Hellwig Valentin ist Universitätsdozent für Allgemeine Zeitgeschichte an der Universität Graz und war 1998-2010 Leiter der Unterabteilung Wissenschaft im Amt der Kärntner Landesregierung. Er ist Mitherausgeber eines Bandes über die Historiographie zur Kärntner Volksabstimmung (2002) und hat das Buch „Der Sonderfall. Kärntner Zeitgeschichte 1918-2004/08“ (2005, Neuaufl. 2009) verfasst.
Reinhard Stauber ist Universitätsprofessor für Neuere und Österreichische Geschichte an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und Mitglied der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Dort verantwortet er die Editionsreihe „Die Protokolle des bayerischen Staatsrats 1799-1817“. Zuletzt hat er sich vor allem mit dem Wiener Kongress und dessen europäischem Friedenssystem befasst („Der Wiener Kongress“ (2014)).
Zur Veranstaltung
Die Veranstaltung ist Teil der Reihe Utopia! Ist die Welt aus den Fugen? Beiträge zur Kunst der Aufklärung (veranstaltet von der Universität Klagenfurt gemeinsam mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften).
Die Veranstaltung ist Teil von: